Christian Näthe im Interview: „Ich wünsche mir eine Sensibilisierung für die gegenseitigen Geschichten“
Im aktuellen Kinofilm „Mit der Faust in die Welt schlagen“ spielt Christian Näthe einen Vater, dessen zwei Söhne in einem Dorf in Sachsen immer mehr in rechte Kreise abzurutschen drohen. Der Film basiert (lose) auf dem erfolgreichen Roman von Lukas Rietzschel, den vielleicht einige von euch schon gelesen haben. Ob ihr die Romanvorlage kennt oder nicht, spielt für den Kinobesuch allerdings gar keine Rolle, denn diese Wucht von Film wird euch auf jeden Fall mitreißen. Und vielleicht auch ein bisschen verloren zurücklassen. Das muss aber gar nichts schlimmes sein, denn dann können wir ins Gespräch kommen.
Ich hatte das große Glück, dass die Regisseurin Constanze Klaue (das Interview lohnt auf jeden Fall auch) und der Schauspieler Christian Näthe sich viel Zeit für alle meine Fragen genommen haben. Über den Film, über die DDR, über erschöpfte Eltern und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Christian Näthe kennen sicher einige von euch, seit seinem 14. Lebensjahr steht er vor der Kamera, in Kinofilmen wie „Baader-Meinhof-Komplex“ oder „Soloalbum“, aber auch in vielen verschiedenen Serienformaten. Im Interview gehen wir sehr tief rein, aber ich bin mir sicher: Wenn ihr vorher noch nicht über einen Kinobesuch nachgedacht habt, nach dem Interview habt ihr es bestimmt.

Interview mit Christian Näthe zu „Mit der Faust in die Welt schlagen“
Christian, ich freue mich sehr, dass es mit unserem Interview klappt. Ich finde „Mit der Faust in die Welt schlagen“ so einen guten Film, da will ich doch gern mit dir drüber sprechen.
Christian Näthe: Natürlich! Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Die Sonne scheint, die Leute sitzen auf der Picknickdecke und müssen trotzdem ins Kino gehen.
Und dann müssen sie sich noch mit so einem schweren Thema beschäftigen – was aber so wichtig ist.
Wenn ich mit Leuten spreche, dann ist das Feedback oft: Krasser Film, das muss ich erst mal verdauen. Wenn ich das weiterdenke, dann frage ich mich, ob die Menschen gerade resilient genug sind, um sich das anzugucken. Ist eine Vielzahl von Menschen nicht schon darauf konditioniert, dass, wenn es Druck gibt, Filme eher Zerstreuung und leichte Unterhaltung bieten sollten? Ich finde, ein Film muss themenbezogen auch einen Beitrag leisten, eine Diskussion oder – noch besser – Gefühle anstoßen.
Der Film ist super. Ich glaube, die Schwierigkeit ist eher, Menschen zu überreden, sich eben mit den Themen, die hier verhandelt werden, auseinanderzusetzen. Denn es ist ja kein Ostthema. Auch Menschen aus dem Westen kennen sicher den Dorfnazi …
Oder den Blickwinkel, den ein Kind auf das Elternhaus hat. Wir haben als Kinder die manchmal auch unbequeme Möglichkeit, unser Elternhaus komplett zu studieren und Verhaltensmuster vollständig zu übernehmen.
Ich habe letztes Jahr im Ausland gedreht und da zufällig im Hotelzimmer den Film „The Quiet Girl“ gesehen. Es geht um ein Mädchen, das für den ganzen Sommer weggegeben wird – etwas, das im verarmten Irland der 80er Jahre wohl keine Seltenheit in Großfamilien war. Dieses Kind geht in einen komplett neuen Kosmos und sieht, wie liebevoll die Eltern miteinander umgehen – ein großer Unterschied zu ihren eigenen Eltern. Mich hat das so gerührt, weil das ja auch eine Beobachtung ist: wie schön etwas sein kann. Und dass man das erst weiß, wenn man andere Erfahrungen hat.
Um auf unseren Film zurückzukommen: Diese Perspektive aus den Kinderaugen – ich glaube, das macht den Film in Ost und West universell. Da braucht es den Background der Massenarbeitslosigkeit und der Deindustrialisierung im Osten nicht. Diese Perspektive bleibt etwas, was vielleicht alle nachspüren können. Und wenn nicht, dann ist es immer interessant, wo und wann diese Unterschiede auftreten.
Mich triggert das manchmal schon, dass ich merke: Viele haben solche Erfahrungen, aber nicht alle. Auf die, die diese Erfahrungen im Elternhaus nicht gemacht haben, gucke ich dann schon mal fast neidvoll drauf und denke: Aha, so kann das also auch sein!
Ich fand beim Schauen vom Film tatsächlich am schwersten auszuhalten, wie die Eltern mit den Kindern umgehen. Das liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt eigene Kinder habe und da vieles anders mache, gleichzeitig einige Verhaltensweisen aus meiner eigenen Kindheit aber durchaus kenne. Wie ist das bei dir: Hast du in deine Rolle eigene Erfahrungen mit reingebracht?
Natürlich habe ich auch eigene Erfahrungen eingebracht. Ich bin 1976 geboren, und obwohl meine Eltern auf der einen Seite schon recht freigeistig waren, hatte ich auf der anderen Seite durchaus ein ziemlich autoritäres Elternhaus.
Ich muss für meine Rolle nicht alles davon selbst erlebt haben, aber es gab Dinge, da musste ich nicht so weit weggucken. Andere Sachen habe ich aus einer Beobachtung gezogen. Und dann gibt es ja noch meine eigenen Anteile. Ich bin ja selber Familienvater, habe zwei Kinder. Auch wir leben in herausfordernden Zeiten. Ich trage auch Überforderungsanteile in mir oder ganz leichte cholerische Tendenzen. Dieses: „Mann, jetzt zieht euch doch endlich mal an!“ [Er lacht]
Ich mache gewiss nicht alles richtig, auch wenn ich natürlich versuche, es anders zu machen. Aber diese Anteile, die ich in mir auch spüre, die sind durch mein Elternhaus und die relativ autoritäre Schule in mir. Mich triggert das an in der Rolle. Ich muss dann nur, wie bei einem Volumenregler an der Stereoanlage, etwas hochdrehen, und dann bin ich schon bei dem Vater.
Wenn ich dann beobachte, dass andere, so wie du das beschreibst, so behütet groß geworden sind, dann kommt da bei mir auch mal eine leichte Eifersucht, oder auch Zweifel durch. Da frage ich mich auch: War das bei denen wirklich so eine heile Welt? Wie war das bei mir?
Die Lebensrealität, die wir in diesem Film schildern, diese Leute aus der unteren Mittelschicht – die haben wenig Zeit Sowohl der Autor Lukas Rietzschel als auch die Regisseurin Conny [Constanze Klaue] haben da Gleichnisse in ihrer eigenen Biografie.
Das hat schon auch was mit sozialen Verhältnissen zu tun.
Die wenigsten mit einem geringeren Gehalt schaffen es, den Stress nicht mit nach Hause zu bringen, sich da Luft zu machen, sondern wirklich nur abzuschalten. Mit den elektronischen Geräten heutzutage verlängern wir unsere Arbeitszeit eigentlich alle nur noch. Wir nehmen das alles mit nach Hause, die wenigsten von uns schaffen das digitale Fasten doch wirklich.
Wer kommt denn nach Hause und sagt: „Jetzt bin ich nur noch hier!“ Ich bin bei meinen Kindern, ich bin für meine Familie da und vollkommen aufnahmefähig. Im besten Fall habe ich auch noch gute Laune! Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung der Jetzt-Zeit.
Ich habe Constanze im Interview gefragt, ob sie glaubt, dass „Mit der Faust in die Welt schlagen“ wirklich nur in einer bestimmten Zeit spielen kann. Ist das, was da gezeigt wird, heute wirklich so weit von uns weg? Und gab es das nicht alles auch schon mal?
Wir hatten eine Vorpremiere im Kino Delphi, und da war der Soziologe Steffen Mau dabei. Der hat das sehr gut beschrieben. Was ich jetzt sage, hat eine Ostkomponente, aber diese Gefühle verstetigen sich. Meine Freunde, die den aufkommenden Neofaschismus der Wendezeit miterlebt und beobachtet haben, die hatten zum Teil konfrontative Zusammenkünfte und traumatische Erlebnisse. Ich selbst auch. Das war alles Anfang der 90er.
Wir waren dann beim Buchlesen fast überrascht, denn wir reden hier ja von den 2000ern. Da war doch die meiste Gewaltsuppe schon durchgelaufen! Nee, eben nicht! Die haben das auch noch mal wahrgenommen. Und an dem Punkt denke ich: Es wird sich verstetigen.
Der Soziologe hat das dann so erklärt, dass in den Transformationszeiten der Wende eine Wunde, eine Narbe entstanden ist. Etwas, das nicht ausreichend besprochen oder mit „Heilbalsam“ bestrichen wurde, und deswegen heilt diese Wunde nicht aus. Das geht unter die Haut in das gesunde Gewebe über, verhärtet hier und verstetigt sich.
Deswegen fahren auf dem Land Jugendliche, die die DDR nicht mehr erlebt haben, ihre Simi, schrauben an ihr rum. Die Simson – die letzte Gallionsfigur, eines der letzten Überbleibsel von einem Land, das es nicht mehr gibt. Dieses Schrauben an ihr, das kommt ja auch im Film vor.
Es ist dieses tradierte Gefühl der Eltern, vielleicht auch der Großeltern, dass man sich vergewissern muss, dass man noch da ist. Es hat etwas damit zu tun, dass dieses Land verschwunden ist und dass es einen großen Anpassungsstress gab an die neuen Verhältnisse, in denen diese Führungselite, die mehrheitlich in der Wendezeit aus dem Westen kam, offensichtlich als sehr bevormundend empfunden wurde.
Es sind viele Punkte, die da mit reinspielen. Ich glaube sehr wohl, dass diese Form des übersteigerten Stolzes, den wir ja durch das Erstarken gewisser Parteien sehen, eine Rolle spielt. Es gibt einen übersteigerten chauvinistischen Rückgriff auf die Nationalität. Man spürt, dass es leicht ist, den Leuten ein Rückgrat zu geben, wo gerade eine Wunde ist. Das wird auch weiterhin so bleiben.
Die Versprechen des Wohlfahrtsstaates sind auch nicht eingetreten. Es bleibt dabei: Arbeit wird für die meisten in der Bevölkerung immer härter, immer länger. Deswegen weiß ich nicht, ob wir so viel Zeit und Toleranz und gute Laune haben, um unsere Kinder so gut loszuschicken in eine Welt, wie sie es eigentlich bräuchten.
Aber auf welche Welt bereiten wir sie denn auch vor? Jeder von uns hat da ja andere Prioritäten. Meine Kinder werden zum Beispiel mit wenig Medien groß, niemand hat ein Handy. Damit ist meine Tochter aber die Einzige in ihrer Klasse. Mir sind andere Dinge wichtig als anderen Eltern, und das fühlt sich schon auch einsam an.
Ich habe dieselbe Problematik hier zuhause. Ich empfinde das fast als Ehrung, wenn mir Freunde mit älteren Kindern sagen: „Oh, da sind die Kinder aber dann die einzigen, oder?“ Meine Kinder sind an einer Schule, wo nicht alle ein Smartphone haben, aber ich höre jetzt schon: Spätestens in der siebten Klasse kannst du das alles vergessen, da kommen Hausaufgaben und Schulpläne nur über WhatsApp.
An sich denke ich auch: Die Leute haben ja auch recht mit diesen Aussagen. Ich höre von allen Seiten, dass Eltern einknicken, weil sie sich sorgen, dass die Kinder nicht mitkommen, dass sie gemobbt werden. Mir fehlt aber die andere Seite, denn die wird nicht oft genug erzählt. Was ist denn mit denen, die sich verweigern? Was passiert dann?
Den Kampf darum, kein Handy zu haben, den muss mein Kind in der Schule austragen, nicht ich. Da brauche ich aber die Rückmeldung von meinem Kind, dass es stark genug ist, das auszuhalten.
Es wird eine Herausforderung, auf jeden Fall.
Ich finde das gerade spannend, dass wir so ähnliche Erfahrungen haben. Auch was diesen gewissen Stolz angeht. Wenn ich z. B. mit Expertinnen spreche und die dann sagen: „Das ist ’ne gute Entscheidung, den Kindern kein Smartphone zu geben“, dann fühlt sich das kurz gut an. Aber der Gegenwind von den Kindern zuhause, der ist natürlich nicht so ganz angenehm.
Natürlich! Ich kenne das auch. Unsere Nerven sind da ja auch einfach überlastet. Da müssen wir uns auch mal selbst in den Spiegel gucken. Den Kindern ein Handy zu geben, kann Situationen ja auch erleichtern, für alle Beteiligten. Da kommen wir auch wieder auf die sozialen Verhältnisse zurück.
Ich habe im letzten Jahr gut gearbeitet, war deswegen weniger zuhause. Es gibt Momente, in denen ich das jetzt gut auffangen kann, dass meine Kinder nach Hause kommen und ich mich mit ihnen dann beschäftigen kann. Aber manche Eltern kommen von der Arbeit und sind komplett ausgelaugt. Die setzen ihre Kinder dann vor den Fernseher oder das Handy, weil sie keine Kraft haben. Ich will damit nicht alles entschuldigen. Aber ich glaube, die Resilienz der Eltern gegenüber den Forderungen der Kinder hängt ja auch damit zusammen, wie ausgeruht sie sind, wie gut es ihnen selbst geht.
Da kommen wir wieder zurück zu der Familie in „Mit der Faust in die Welt schlagen“. Die Eltern sind total ausgelaugt. Dein Vater macht sein Ding und will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, der Mutter wünscht man eigentlich nur Ruhe und Zeit für sich. Sie ist es, die alles versucht, zusammenzuhalten, aber eigentlich hat sie keine Kraft.
Absolut! Conny, die Regisseurin, hat das so toll inszeniert. Sie hat darauf geachtet, dass wir keinen der Charaktere diskreditieren. Es gibt diese Bilder: Der Vater legt auch mal die Hand auf die Schulter des Sohnes beim Rummel, hält da beim Schießen das Gewehr mit. Am Anfang gibt es das noch. Und dann werden die Daumenschrauben angezogen. Alle sind immer gestresster und immer weniger bereit, sich auf die anderen einzulassen. Das ist doch in der Realität oft zu beobachten.
Der Vater nimmt dann die Fahrkarte in die nächste Verliebtheit mit der Nachbarin. Statt sich dem zu stellen und zu sagen: „Ey, was ist das denn hier mit uns? Wir haben uns ja nicht ohne Grund mal getroffen und verliebt.“ Bei der Mutter, das kann und soll nicht auserzählt werden, aber an ihr kann man die Rolle der Frau in der Familie sehr gut beobachten. Was die alles wuppen muss. Und wenn sie dann im wahrsten Sinne des Wortes hässlich wird, dann wird sie abgestoßen. Das ist echt hart! Mir ist das tatsächlich auch beim Schauen noch mal klar geworden, dass ich dachte: Wahnsinn, wie sehr wir darin verhaftet sind. Wie viel muss eine Mutter stemmen?
Das ist so ein wichtiges Thema. Die Szene, in der der große Sohn Phillip sie besucht und sie da sitzt und eigentlich ganz allein ist – das ist das Schicksal von so vielen Müttern. Die haben alles gegeben, bis eigentlich nichts mehr da ist.
Das ist noch ein anderes weites Feld. Aber hier hat der Film mich noch mal sensibilisiert, da hinzugucken. Ich habe natürlich mehr Einblick in die Rolle des Vaters. Wenn der mit seinem Eisenbahnwaggon kommt und den zeigt, sieht man, dass er sich selbst Mut machen will. Der hat sein Land, seinen Beruf, seinen Halt verloren – der sucht nach etwas Neuem.
Solche Geschichten gibt es doch öfter, wo der Mann sich morgens mit dem Kaffee, der Arbeitstasche und der Zeitung unterm Arm verabschiedet und dann nicht zur Arbeit, sondern zum Biertrinken in den Park geht. Weil dieser Mann es vor seinem Ego und seiner Familie nicht schafft, das zu verantworten.
Um noch mal auf den Osten zu sprechen zu kommen: Im Buch „Wir waren wie Brüder“ hat der Autor das sehr genau beschrieben – diese Unterschiede zwischen Ost und West. Der Osten denkt ja manchmal, er hätte das Monopol auf strukturschwache Gebiete. Das ist ja nicht so. Global gesehen gibt es auch andere abgehängte Gebiete. Aber die Massenarbeitslosigkeit nach ’89, diese Vorwürfe, dass das, was Menschen 40 Jahre lang gemacht haben, Schrott und wertlos sei – das ist ein Hieb in die Magengrube.
In dem Buch wird beschrieben, dass da eben nicht ein Vater aus der Klasse mit der Bierflasche hinter den Garagen gesessen hat, weil das Schamottewerk zugemacht hat, sondern alle. Da ist vielleicht eine leichte Überhöhung dabei, aber stell dir das Leben in der ostdeutschen Provinz doch mal vor, wenn da alles plattgemacht wurde. Das ist eine große Zäsur, fast ein Trauma, eine Narbe, die es zu besprechen gilt. Und die wirkt nach.
Bei unserem Film höre ich immer wieder, dass die Eltern ja nichts sagen. Aber das können die gar nicht – das haben sie nicht im Repertoire. Weil sie es selber nicht bekommen haben.
Ich kenne das auch. Mein Opa war Widerstandskämpfer und in Buchenwald. Der hat nie über Gefühle geredet, weil er das nicht konnte. Nicht mit mir, nicht mit seinem Sohn, meinem Vater. Aber das Schweigen über Gefühle löst sich nicht nach einer Generation auf. Wenn man das nicht selbst erlebt, kann man das aber vielleicht auch nicht verstehen, was man da im Film auf der Leinwand sieht.
Wir sind jetzt erst die dritte Generation nach dem Krieg. Überleg doch mal, wie lange das nachwirkt! Dein Opa hat – zumindest für mich – auf der richtigen Seite gekämpft, aber das hatten ja die wenigsten. Wir hatten Großväter, die an der Front gekämpft haben, die gefallen sind, die Mitläufer oder Schlimmeres waren. Da schwingt auch so eine Schuld mit.
In den Büchern über die Kriegsenkel und Kriegskinder wurde das auch beschrieben – da gab es eine absolute Abnabelung vom Gefühl. Aber das brauchst du als Kind. Du brauchst eine Umarmung, du brauchst Zuwendung.
Das Elternhaus, das wir im Film zeigen, lebt ja schon ohne physische Gewalt. Wir haben das Klischee ja gar nicht ausgepackt. Die Gewalt findet auf einem anderen Sektor statt: auf dem mentalen, im Ausbleiben von Empathie, im Ausbleiben von Umarmungen.
Das ist eine gesamtdeutsche Erfahrung – mit dem Unterschied, dass der Westen immerhin ’68 hatte. Da hat sich eine Generation von Nachkriegskindern, Jugendlichen, aufgelehnt gegen dieses Verstummen, gegen dieses „immer weiter so“. Da gab es schon mal was, das sich Bahn gebrochen hat. Das fehlt dem Osten in der Auseinandersetzung mit seiner eigenen Geschichte.
Wenn wir da nicht aufpassen und uns auch über diese kritischen Sachen unterhalten, dann wird der Osten auf einmal zu einer Wärmestube, die im Nachgang verklärt wird. Das sollte auch nicht sein. Man muss die Gleichzeitigkeit aushalten – dass es beides gab. Und ich mit Recht behaupten kann: Ich habe im Osten eine glückliche Kindheit verlebt.
Ich versuche als Vater hinzuschauen. Du musst checken, wann dein Kind eine Umarmung braucht. Wenn sie kuscheln wollen, wenn sie etwas erklärt bekommen möchten. Sie wollen an deinem Leben teilhaben. Denen reicht ein kurzes Wegbügel-Argument nicht – die musst du auf Augenhöhe betrachten. Wenn uns das gelingt und wir das weiterhin als Gesellschaft zelebrieren, dann haben wir vielleicht eine Generation von Kindern geschaffen, die nicht autoritär ist, die nicht beim nächsten Anpfiff sofort an die Front rennt und Krieg spielt.
Was hat dich an der Rolle gereizt?
Mich hat das ganze Buch gereizt. Wenn ich ein Buch sehe, bei dem ich merke, das trifft einen Nerv bei mir – da erkenne ich etwas Selbsterlebtes drin, da bringt mich etwas zum Weinen – dann bin ich interessiert. Ich hätte auch eine andere Rolle gespielt, aber mir wurde zum Glück der Vater angeboten. Im Gesamtkonzept konnte ich das alles auch gut nachvollziehen. Das war jetzt kein Börsenmakler, bei dem ich mir gewisse Verhaltensmuster erst aneignen müsste, sondern da waren viele Sachen drin, bei denen ich sofort dachte: „Jut, machen wa!“ [Er lacht]
Es brauchte für mich keinen großen Reiz im Sinne von Überzeugung. Ich wollte Teil von diesem Ensemble sein, von der Idee des Buches und des Films. Es war eher ein: „Na klar, natürlich machen wir das zusammen!“
Wir haben dann auch Leseproben gehabt – und die beiden Kinder sind so toll. Das ist Connys Verdienst, da so eine gute Nase zu haben und zu merken: Die beiden Jungs sind so gut. Und gleichzeitig hat sie ihnen ja auch einiges abverlangt. Wenn es so super läuft wie hier, dann macht sich so ein Beruf eigentlich fast von allein.
Was wünschst du dir, was Leute aus dem Film mitnehmen?
Ich hoffe erstmal, dass viele Leute diesen Film sehen und sich dem auch aussetzen. Denn es ist auch ein Stück Realität, die da abgebildet wird – und mit der müssen wir uns auch beschäftigen.
Ich wünsche mir eine Sensibilisierung für die gegenseitigen Geschichten. Das Feedback, das ich bekommen habe, ist, dass der Film zur Selbstreflexion einlädt. Der wirkt mehrere Tage nach. Natürlich wünsche ich mir, dass man da überlegt, wie es anderen wohl geht – ob Ost und West oder der Nachbar auf der anderen Straßenseite.
Da zu sehen, was noch dazu kommt, was Entscheidungen beeinflusst – das hilft. Wir sehen im Film den Werdegang der Kinder und auch, wie die in diesen Strudel geraten. Eine für mich tolle Szene ist die, in der Phillip, der Ältere, seinen Mut zusammennimmt und zu Ramon fährt. Im Buch kommt das noch mal ein bisschen besser raus: Phillip will, dass es wie eine zufällige Begegnung aussieht, aber er plant das natürlich. Er fährt da hin, nimmt seinen Mut zusammen und klingelt bei Ramon. Und er darf mitschrauben, er findet langsam Einlass in diesen Kreis.
Es gibt die Szene, wie er danach mit dem Fahrrad durchs Rapsfeld fährt und sich wie ein Held fühlt. Da könnte ich weinen, weil ich das so gut nachempfinden kann. Der Vater ist nicht mehr richtig da – er sucht diese väterlichen Anteile in den vermeintlich starken Jungs.
Mir ist es aber noch wichtig zu sagen: Es gibt Leute aus noch viel prekäreren Verhältnissen, die keine Arschlöcher geworden sind. Die sich nicht dieser rechten Verlockung von vermeintlicher Stärke und Brutalität als Macht und für Wirksamkeit anschließen. Die gibt es auch – und das sollten wir nicht vergessen.
„Mit der Faust in die Welt schlagen“ könnt ihr aktuell im Kino anschauen. Schreibt mir nach dem Filmbesuch unbedingt, was der Film bei euch so ausgelöst hat. Denn ich bin mir sicher, dass sich darüber noch ganz viele Gespräche führen lassen würden.



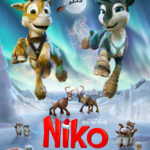






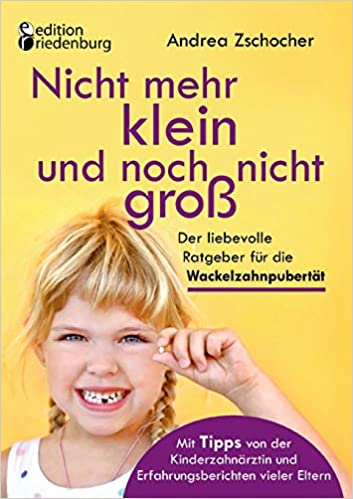
Eine Antwort
[…] erfordern es irgendwie trotzdem) Lest euch, nach dem Interview mit Constanze auch gern noch das Gespräch mit Christian Näthe durch, der im Film den Vater […]