Constanze Klaue: „Ich wollte bewusst in den Grauzonen bleiben“
„Mit der Faust in die Welt schlagen„* basiert (lose) auf dem Roman von Lukas Rietzschel und beschäftigt sich mit zwei Brüdern (und ihrer Familie) im Osten Deutschlands. Genauer in Sachsen, jenem Bundesland, das auch heute noch immer wieder in den Schlagzeilen ist für hohe AfD-Quoten, rechtsradikale Ausschreitungen und Hoffnungslosigkeit. Natürlich ist nicht ganz Sachsen so, das wäre eine sehr einfache Antwort auf sehr komplexe Probleme.

Constanze Klaue hat sich der Aufgabe gestellt das Buch zu verfilmen und dabei eben überhaupt keine einfachen Antworten zu geben. Sondern uns mit vielen Fragen zurücklassen, mit der Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn auch wenn „Mit der Faust in die Welt schlagen“ per se Erlebnis und vom Setting her eine Ostgeschichte ist, was dort passiert ist nicht unbedingt ein Ostproblem. Denn Dorfnazis gibt es nicht nur im Osten. Hoffnungslosigkeit gibt es auch nicht nur hier. Und so habe ich mit Constanze über genau diese Themen gesprochen, u.a. über die Frage: Ist es nur ein Ostproblem der Nullerjahre? Hat sich wirklich was verändert? Und was kann vielleicht helfen und Perspektive bieten? Denn klar ist es wichtig zu beschreiben was war und was ist. Aber wir brauchen ja ganz dringend auch einen Weg in die Zukunft.
Constanze Klaue: Mit der Faust in die Welt schlagen
Die Regisseurin Constanze Klaue hat mit ihrem Film „Mit der Faust in die Welt schlagen“ eine Wucht von Film geschaffen. Ich fand ihn sehr intensiv, lange nachhallend und so viele Fragen aufgreifend, dass ich euch nur empfehlen kann: Wenn ihr die Chance habt, in eine Vorstellung zu gehen, bei der es im Anschluss noch eine Diskussionsrunde gibt, nehmt das wahr. Tauscht euch aus, besprecht den Film weiter. Bleibt im Austausch, weil wie so viele Ideen wie nur möglich brauchen, damit sich Dinge im Sinne der Demokratie und des Miteinanders verändern. (Dass ich überhaupt darüber nachdenken muss hier zu erwähnen, dass es natürlich um demokratische Ideen geht, macht mich wütend. Ich weiß, dass ihr das wisst, aber die Zeiten erfordern es irgendwie trotzdem) Lest euch, nach dem Interview mit Constanze auch gern noch das Gespräch mit Christian Näthe durch, der im Film den Vater spielt.
Interview mit Constanze Klaue

Constanze, welche Figur in deinem Film ist deine Lieblingsfigur?
Constanze Klaue: Das ist schwierig, denn ich mag wirklich alle sehr gern, obgleich ich nicht zwingend mit ihrem Verhalten einverstanden bin. Im Roman war es, unabhängig von den Hauptfiguren, auf jeden Fall Uwe. Ich finde ihn spannend, weil er ein bisschen das Geheimnis ist, das durch den Film trägt. Er ist beinahe eine mystische Figur, das schlechte Omen, die Vorahnung, die zeigt, was mit der Familie Zschornak passieren könnte: Haus weg, eine Stasivergangenheit, aus der er sich nicht befreien kann, Arbeit weg, die Kinder haben Angst vor ihm, die Frau verklagt ihn, er bekommt keine Hilfe. Mehr darf ich nicht spoilern.
Generell muss ich sagen, dein Film ist extrem eindrücklich. Er basiert auf dem Buch „Mit der Faust in die Welt schlagen“ von Lukas Rietzschel. Buch und Film spielen zwischen 2005 und 2015. Glaubst du, dass sich in den Provinzen, um die es in deinem Film ja auch geht, so viel in den letzten zehn Jahren verändert hat?
Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Wir hatten vor Kurzem auch eine Vor-Premiere im Delphi Filmpalast mit anschließender Podiumsdiskussion, u. a. mit der Aktivistin und Politikerin Lilly Blaudszun. Sie ist ja nochmal ein anderer Jahrgang, sie ist 2001 geboren. Und trotzdem entspricht das alles auch ihrer Erfahrung. Auch sie ist so aufgewachsen, auch sie kennt die Dorfnazis.
Man sieht ja außerdem an den AfD-Zahlen, dass sich gerade die Jugend wieder total Richtung rechts entwickelt. Ob das jetzt tatsächlich nur TikTok oder Instagram ist, weil die AfD besser in den sozialen Medien unterwegs ist, weiß ich nicht. Das ist bestimmt auch ein Grund. Denn es ist etwas, was die anderen Parteien verpennt haben.
Aber es zeigt sich auf jeden Fall, dass sich die Zeiträume, in denen das passiert, leider so ein bisschen flexibel verschieben lassen. Ich bin eher in den 90ern und frühen 2000ern aufgewachsen, der Roman spielt in den 2000ern. Und trotzdem beschreibt der ungefähr das, was ich damals erlebt habe.
Jetzt gibt es wieder eine Generation, die das zehn Jahre später erlebt hat. Da fragt man sich natürlich schon: Wie kann das sein?
Aber auf der anderen Seite: Wenn nichts Neues entsteht und diese Landstriche mehr oder weniger nach wie vor so bleiben, wie sie sind, nämlich leer und alt, wenn es keine wirklich großen Strukturveränderungen gibt, was soll sich ändern? Wenn es kein Bewusstsein dafür gibt, dass man an diesen Orten aktiv werden muss. Und damit meine ich nicht, dass man dann immer nur Anti-Rechts-Projekte machen muss. Es fängt ja tatsächlich mit den fehlenden Perspektiven an.
Ich bin auch so aufgewachsen und das nicht in der Provinz. Aber auch ich kenne das, dass es Nazis gibt, die nicht Glatze, Bomberjacke und Springerstiefel tragen, Leute, mit denen man schon auch mal geredet hat, die aber eben diese Gesinnung haben.
Das fand ich total wichtig, dass wir da nicht in die Klischeekiste greifen und dieses Bild von den typischen Glatzen, die man so aus dem Bilderbuch kennt, bedienen. Ich wollte bewusst in den Grauzonen bleiben.
Sowohl Ramon als auch Menzel und Timo, der immer mal auftaucht, das sind alles so Typen, wo du nicht genau weißt, was mit denen los ist. Sie sind ein bisschen prollig, so ein bisschen „weiß nicht“. Die könnten alles sein und genau darin liegt, glaube ich, auch die Gefahr.
Da kann man sich einerseits dann doch krasser radikalisieren, es auf der anderen Seite aber auch als harmlos empfinden und mitmachen. Man merkt ja auch den Dreien an, dass sie es selbst nicht so richtig wissen. Sie trinken Sternburg, also „Zeckenbier“, weil das günstig ist. Das lässt man dann auch nicht stehen. Gleichzeitig trifft man sich halbwegs motiviert in irgendwelchen Bungalows, um bei Reichsflaggen Musik zu hören und sich zu besaufen.
Das Spannende ist ja auch: Denken wir an Nazis, denken wir an Ausländerfeindlichkeit, Hass gegen Geflüchtete. Aber die Nazis im Film, die hassen auch die Sorben. Das ist nicht das, was man im ersten Moment mit Nazis in Verbindung bringt.
Das ist gut, denn es war mir wichtig, die Geflüchteten da tatsächlich rauszuhalten. Die Idee dafür ist ganz einfach: Karge Gegenden in Deutschland haben kein Problem mit Geflüchteten oder generell Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt sie dort nicht oder kaum, das ist ein Phantom, das da herrscht.
Auf der anderen Seite kann man aber tatsächlich in der Lausitz ganz gut erkennen, wie das im Kleinen beginnt. Mit dem Hass auf die Sorben. Das ist tatsächlich eigentlich ein Hass untereinander. Denn die Sorben sind ja gleichzeitig genauso deutsch.
Ich glaube, bei den Sorben ist es auch nochmal speziell, weil sie im Vergleich zu den „nur Deutschen“ eine eigene Identität und eine eigene Sprache haben. Sie sind viel mehr verwurzelt, obwohl sie in der Vergangenheit permanent entwurzelt wurden. Sie haben eine Tradition, etwas, auf das sie sich besinnen können, einen Halt.
Den haben die anderen in der Regel nicht. Und ich glaube, dass da ganz viel Neid mitspielt. Denn es wird immer gesagt, die Sorben haben die schöneren Dörfer, die haben die besseren Bäcker, die besseren Schulen und so weiter. Aber am Ende geht es darum, dass sie vor allem eine Identität haben und vielleicht so etwas wie Heimat besser definieren können.
Im Film gibt es ja auch das Mädchen, das sagt, dass sie jetzt sorbisch lernt und aufs Gymnasium geht. Sie entwickelt sich also, obwohl sie aus dem gleichen Dorf kommt wie die beiden Jungen, ganz anders. Aber das ist ja eigentlich kein Ostding. Das kennen Menschen aus dem Westen doch auch, oder?
Ich höre das tatsächlich immer wieder auch von Leuten, die im Westen in ländlichen Regionen aufgewachsen sind. Da gibt es diese Probleme genauso, aber weniger stark. Als ich in NRW gewohnt habe, sind mir gerade die Unterschiede zwischen Ost und West aufgefallen. Wenn ich da am Wochenende ins Bergische Land wandern gegangen bin, da sind die Dörfer schon anders strukturiert als im Osten. Sie sind mit Menschen gefüllt, die dort sehr, sehr gut leben. Und das ist alles auch angeschlossen an ein Netzwerk, angebunden an die Städte. Dort sind die Dörfer eher eine Verlängerung der Städte. Das ist im Osten nicht so. Aber NRW ist natürlich sehr dicht besiedelt, in anderen alten Bundesländern sind die Probleme des Ostens genauso zu spüren.
Ich glaube, in den Dörfern im Westen wird vielleicht auch mehr aufeinander geachtet. Im Osten ist es vereinzelter, da wird nicht so genau hingeschaut, was der Nachbar da eigentlich treibt. Vielleicht ist das eine Lehre aus der Stasizeit?
Das könnte sein. Aber ich glaube, dass ganz generell der Fokus dafür einfach nicht da ist. Mir ist aufgefallen, dass die Menschen zumindest in Köln sehr viel freundlicher sind. Die Behörden zum Beispiel eine viel längere Leitung. Man ist da nicht sofort genervt, sondern begegnet einander erst mal offen und freundlicher. Ich habe mich gefragt, warum das in Brandenburg und auch Berlin so anders ist. Vielleicht ist es ein Stück weit eine Mentalitätsfrage. Aber ich glaube nicht, dass es nur das ist. Das hat auch was mit dem zu tun, was du gesagt hast. Und damit, dass es hier weniger Kapazitäten gibt.
Ich habe mich mal mit einer Ärztin unterhalten, die in Brandenburg in einem Krankenhaus gearbeitet hat. Sie war total überrascht, als da nachts mal ein vermutlich Geflüchteter aus einem Heim kam und wie sie da mit Fremdenfeindlichkeit konfrontiert wurde. Das komplette Pflegepersonal war, obwohl der Mensch sichtlich Hilfe braucht, total anti. Er konnte kein Deutsch und nur ganz wenig Englisch, und alle waren maßlos damit überfordert, ihm zu helfen und haben extrem degradierend reagiert.
Ich habe mit der Ärztin darüber gesprochen, warum das so ist. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil ich das auch aus meiner eigenen Erfahrung kenne: Wenn ich überfordert und selbst komplett auf Anschlag bin, dann kann ich mein Herz nicht mehr für das Leid anderer öffnen
Ich weiß es nicht, aber ich frage mich manchmal, ob das wirklich nur eine Mentalitätsfrage ist. Es ist bestimmt auch viel Mentalität, was ich auch sehr charmant finde. Dass man eben nicht immer einer Meinung ist. Aber ich glaube, es hat auch etwas mit einer gewissen fehlenden Kapazität zu tun.
Jetzt sprechen wir so intensiv über den Osten. Hast du Angst, dass du ab jetzt immer mit diesem Thema behaftet sein wirst? Dass du zu einer Art Osterklärerin gemacht wirst?
Ja, das habe ich auf jeden Fall. Zumal mein nächster Film das Thema auch mehr oder weniger behandeln wird. Im Kern geht es da noch mal um etwas anderes, es geht um Frauengeschichte. Es ist die Verfilmung von „Superbusen“. Für dieses Projekt wurde ich ungefähr zeitgleich mit „Mit der Faust in die Welt schlagen“ angefragt. Bei „Mit der Faust in die Welt schlagen“ geht es vor allem um die männliche Perspektive und während des Schreibens sehnte ich mich schon sehr danach, der weiblichen und linken auch einen Raum zu geben. Daher kam „Superbusen“ sehr gelegen.
Es war schön, diese beiden Blickwinkel und Stoffe zu entwickeln. „Superbusen“ wird dieses Jahr gedreht und ich freue mich darauf. Ich denke, bei dem Film werde ich dann nicht nur auf den Osten reduziert, da geht es dann eher um Körperbilder, ums Frausein und viel viel Pop. Aber die Angst ist schon irgendwie da.
Wir hatten vor ein paar Tagen ein Screening mit Andreas Dresen in Potsdam. Und der wird auch immer als Ostfilmer gesehen. Er hat natürlich einige Filme gemacht, die den Osten thematisieren, aber er hat auch sehr, sehr viele andere Filme gemacht.
Es ist ja auch ehrlicherweise einfach so, dass die Medien gern mal Dinge aufnehmen. Du kommst selbst aus dem Osten, machst Filme über den Osten, dann wirst du zu einer Posterfigur für dieses Thema. Wärst du aus dem Westen, es wäre eine andere Nummer.
Ja, das stimmt. Ich merke auch, dass die meisten Anfragen, die ich bekomme, Bücher und Themen zum Osten sind. Ich bin auch Musikerin, ein großer Vorteil. Deswegen schreibe ich gerade für eine Londoner Regisseurin ein Drehbuch über Fanny Mendelssohn-Bartholdy. Es gibt also auch andere Themen.
„Mit der Faust in die Welt schlagen“ läuft ab 3.4. in den Kinos. Schaut euch den Film an und schreibt mir gern, wie er euch gefallen hat. Kanntet ihr das Buch schon?



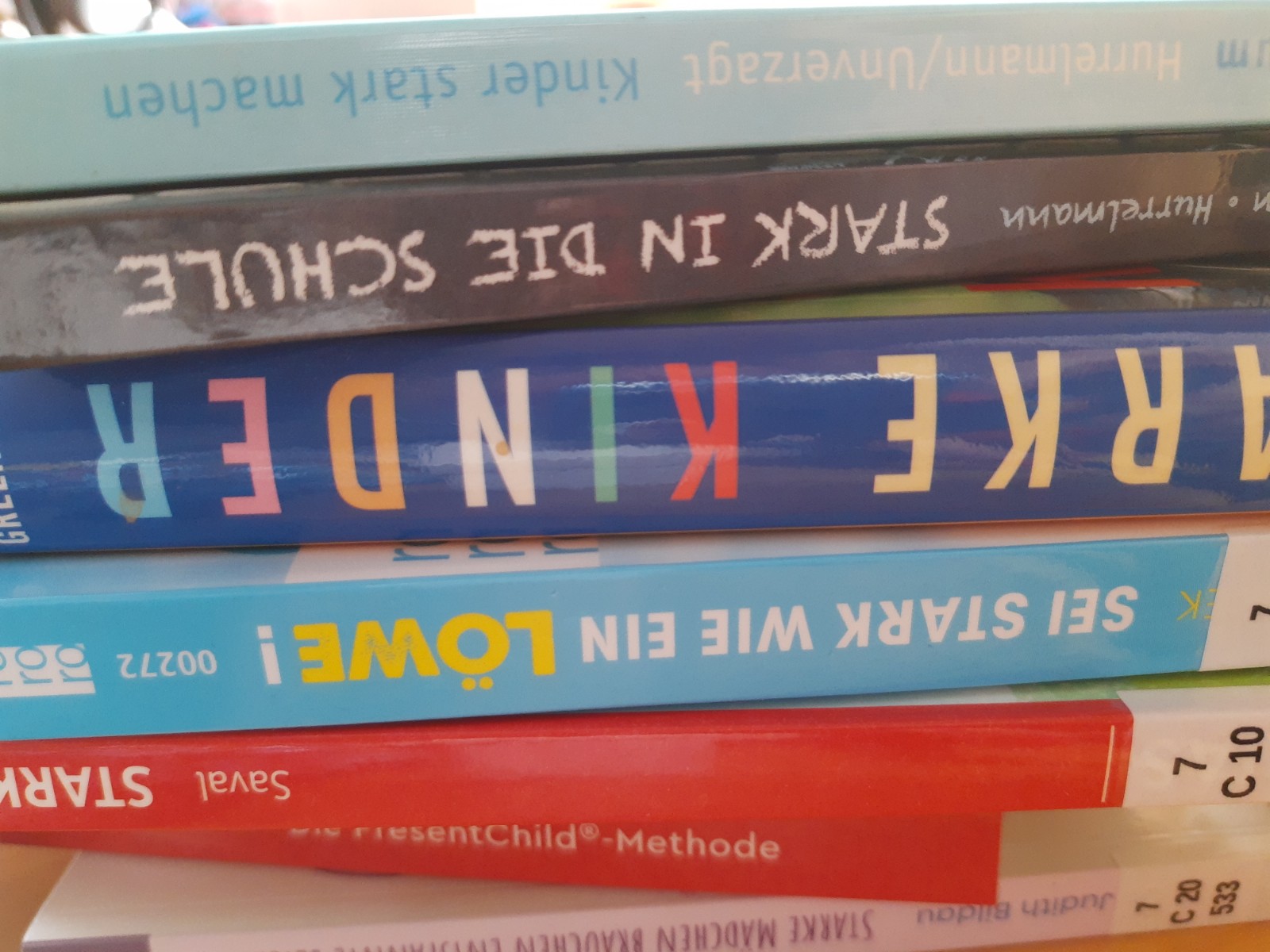
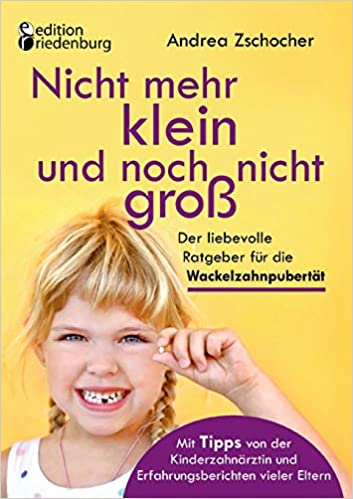
2 Antworten
[…] hatte das große Glück, dass die Regisseurin Constanze Klaue (das Interview lohnt auf jeden Fall auch) und der Schauspieler Christian Näthe sich viel Zeit für […]
[…] glaube, viele Leute sind sehr gestresst von ihrem Leben. Ich habe das letztens mit der Regisseurin Constanze Klaue besprochen. Sie meinte auch, dass man, wenn man selbst so am Limit ist, nicht mehr offen und […]