Andrea Newerla: „Die romantische Liebe und die Kleinfamilie haben sich in Europa auch deshalb durchgesetzt, weil sie sehr gut zum kapitalistischen System passen“
Auf das Interview mit der promovierten Soziologin Dr. Andrea Newerla habe ich mich so gefreut. Weil ich ihr Buch „Das Ende des Romantikdiktats“ verschlungen habe und weil ich so gern mit Menschen über Dinge spreche, die ich noch nicht so recht verstehe. Denn klar wollen wir alle geliebt werden und lieben. Wie kann es also sein, dass Andrea da plötzlich über das Ende der Liebe spricht? Bevor ihr euch jetzt aufregt: Tut sie gar nicht. Aber sie bietet viele kluge neue Ansichten zu dem Thema, mit denen wir uns auseinandersetzen können.

Dr. Andrea Newerla ist promovierte Soziologin, Beziehungsberaterin und Autorin. Sie hat an verschiedenen Universitäten zu Intimitäten, Onlinedating und Beziehungen jenseits heteronormativer Standards geforscht, bevor 2023 ihr Buch „Das Ende des Romantikdiktats„* erschien. Als Expertin zu neuen Formen des Zusammenlebens ist sie regelmäßig in den Medien präsent und bietet neben ihrer Beratungstätigkeit Workshops zu verschiedenen Themen rund um Beziehungen an. Mehr über Andrea findet ihr u.a. auf andrea-newerla.de und auf ihrem Insta-Account.
Interview mit Andrea Newerla
Andrea, was hast du denn gegen die romantische Liebe?
Andrea Newerla: Gar nichts. [Sie lacht] Im Gegenteil, ich finde sie sehr schön. Ich bin selbst romantisch verpartnert und merke auch an mir die Herausforderung des Romantikdiktats. Es ist kein Geheimnis – ich sage das immer wieder gern: Vor zwei Jahren, als mein Buch rausgekommen ist, habe ich meinen aktuellen Partner kennengelernt und war sozusagen live dabei, diese ganzen Prozesse mitzuerleben, die ich ja selbst bei mir beobachte und gegen die ich arbeite.
Ich muss tatsächlich ganz bewusst und aktiv gegen bestimmte normative Vorstellungen anarbeiten, die natürlich auch in mir ihre Wirkung zeigen, weil ich für mich entschieden habe, dass ich so nicht leben möchte. Ich habe genug schmerzhafte Erfahrungen in meinem Leben gemacht und das Scheitern romantischer Beziehungen erlebt, weil ich bestimmten Skripten gefolgt bin, ohne darüber nachzudenken.
Ich glaube, eine aktive Gestaltung romantischer Liebesbeziehungen ist möglich. Ich nenne das die Dezentralisierung der romantischen Liebe – also mehr Menschen in das Zentrum meines Lebens zu holen. Das kann die romantische Liebe auch retten. Denn dann muss sie nicht mehr alles sein und alles erfüllen, was meine Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen im Leben betrifft. Diese Bündelung auf eine Person ist meiner Ansicht nach einfach eine Überfrachtung und zu viel. Ich glaube, daran zerbrechen viele Liebesbeziehungen.
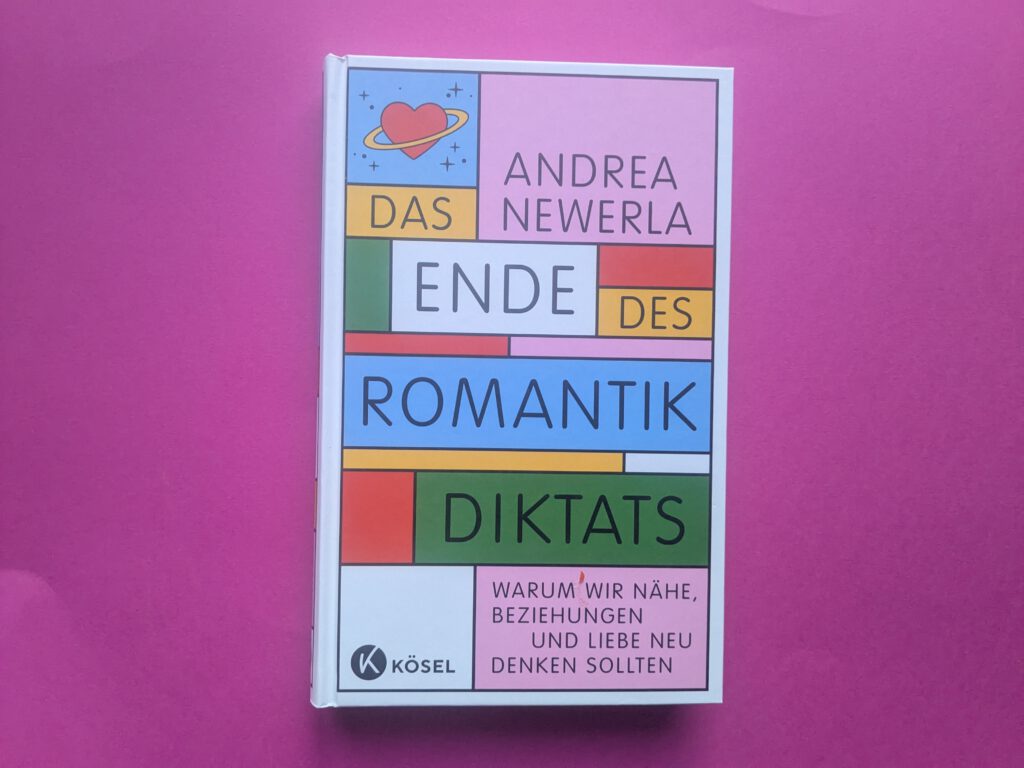
Ich hatte beim Lesen deines Buches das Gefühl, da holt mich mal jemand ab mit Sachen, die mich umtreiben, zu denen ich aber nur eine diffuse Meinung und keine Fakten habe. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass Menschen, die aktuell in ihren Zwanzigern sind, ganz anders mit Liebe umgehen als ich mit Anfang 40. Da wird plötzlich viel mehr in Frage gestellt von dem, was ich immer als gegeben hingenommen habe. Bin ich mit dem Gedanken allein?
Bei mir hat das – ich beschreibe es ja auch in meinem Buch – mit Mitte 30 mit einer bestimmten Erfahrung stattgefunden: diese Auseinandersetzung und die Transformation von einer Liebesbeziehung in eine andere Form.
Du meinst Fritz, richtig?
Ja! Fritz ist jemand – es gibt ihn ja wirklich – der ein Mensch im Zentrum meines Lebens geblieben ist. Es gibt auch andere, natürlich. Aber ich glaube, diese Erfahrung hat mich tatsächlich ins Nachdenken über den Wandel von Intimität und Nähe gebracht, ohne gleichzeitig Verbindlichkeitsvorstellungen über den Haufen zu werfen. Das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt.
Ich glaube, junge Menschen heute denken vielfältiger über diese Dinge nach. Gleichzeitig wirkt das Romantikdiktat nach wie vor sehr stark. Wenn wir uns anschauen, welchen Aufschwung diese New-Adult-Romane bekommen: Die erzählen ja immer wieder dieselbe Geschichte mit ein paar Abwandlungen und Nuancen. Da ist die Person mal ein Vampir oder jemand anderes. Aber im Prinzip geht es immer um diese Anbahnungsphase des Verliebens.
Und das Interessante ist ja, dass diese ganzen Geschichten eigentlich gar nicht erzählen, wie es dann weitergeht. Der Plot endet immer dann, wenn die beiden sich nach vielen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten endlich gefunden haben und ein Paar sind. Aber wie sie diese Partnerschaft, ihre Liebesbeziehung, dann gestalten, das wissen wir eigentlich nicht. Von den Höhen und Tiefen kriegen wir auch nichts mit. Der Fokus in diesen Erzählungen liegt ganz stark auf der Entstehungsphase, und natürlich wachsen junge Menschen mit genau diesen Geschichten auf.
Es wäre total spannend zu untersuchen, wie sie mit dieser Ambivalenz umgehen, die sie mit Sicherheit haben. Einerseits gibt es diese New-Adult-Romane, andererseits eine Vielfalt von intimen Beziehungen, von denen sie ja durchaus mitbekommen, die sie über Online-Dating vielleicht selbst sehen. Es gibt viele Menschen, die in verschiedenen Konstellationen ihre Beziehungen organisieren und leben. Ich glaube, es ist nicht einfach, mit diesen Ambivalenzen umzugehen. Ich wüsste nicht, dass es dazu aktuell Forschungen gibt.
Als du das gerade gesagt hast, habe ich auch sofort gedacht: Uns fehlen die Vorbilder, wie es nach der Phase der Verliebtheit weitergeht. Denn irgendwann steckt man da drin, und dafür gibt es kaum Beispiele. Wie schaffen wir es denn, unsere Beziehungen zu transformieren, wenn wir merken, dass sich etwas ändert? Du hast das mit Fritz ja so schön beschrieben. Aber dazu muss es die Bereitschaft auf beiden Seiten geben. Du schreibst im Buch auch über eine gewisse Sprachlosigkeit. Da denke ich sofort: Wenn uns die Worte und die Vorbilder fehlen, wie gestalten wir dann neue Ideen?
Ich habe keine Anleitung geschrieben, wie du deine Beziehung transformieren kannst. Mir war es mit dem Buch wichtig, überhaupt erst einmal auf das Phänomen hinzuweisen und auf die Ambivalenzen, die im Online-Dating in der Kennenlernphase vorkommen, aufmerksam zu machen. Dazu habe ich ja auch geforscht, bevor ich dieses Buch geschrieben habe. Aktuell habe ich das Manuskript für mein zweites Buch „Wie Familie, nur besser“ eingereicht, in dem ich über Wahlfamilien schreibe. Das ist der nächste Schritt.
Da geht es um die Frage: Wie kann ich andere Formen von Beziehungen gestalten? Ich habe dazu Menschen befragt, die in wahlfamiliären Konstellationen leben, und gebe Einblicke. Tatsächlich habe ich auch schon länger darüber nachgedacht, dass es vielleicht dann ein nächster Schritt wäre, anhand meiner eigenen Transformation Einblicke zu geben, wie so etwas gehen kann. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
Ich glaube, das treibt wirklich viele Menschen um, weil es nicht einfach ist. Du hast es ja auch gesagt: Es gibt kaum Sprache, Worte, Vorbilder dafür. Das haben wir vielfach einfach nicht. Ich habe zum Beispiel neulich einen Workshop gepostet, den ich anbiete – angelehnt an das Romantikdiktat – zum Thema: Wie kann ich Beziehungen anders gestalten? Wie kann ich Glaubenssätze hinterfragen?
Und da nehme ich wahr und habe auch das Feedback bekommen, dass sich Menschen, die schon ein paar Schritte auf dem Weg gegangen sind, einen Raum wünschen, um sich auszutauschen. Denn da kommen dann neue Herausforderungen auf einen zu, weil wir den Weg ja nicht kennen, den wir da gehen. Wir müssen uns ganz langsam vortasten und schauen: Ist der Weg gefährlich? Ist er steinig? Ist er wunderschön? Wahrscheinlich hat er alles davon.
Das Unbekannte macht bekanntlich auch ein bisschen Angst. Gleichzeitig birgt es auch neue Potenziale. Es gibt zumindest Chancen, dass auch diese Form von Zusammenleben glücklich machen kann, dass sie erfüllend sein kann und der romantischen Liebe einen neuen Platz in den Lebenszusammenhängen gibt, die wir dann vielleicht kreieren.
In meinen Interviews mit Menschen, die in wahlfamiliären Konstellationen zusammenleben, habe ich festgestellt: Es gibt viele, und es muss nicht unbedingt das Rad neu erfunden werden. Es ist wichtig, Sichtbarkeit zu erzeugen und zu zeigen, wie Menschen das machen.
Ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die ihre Liebesbeziehungen transformiert haben – in welche Richtung auch immer. In den letzten Jahren wird zum Beispiel mehr über offene Liebesbeziehungen oder offene Ehen gesprochen. Dabei liegt der Fokus in der Regel vor allem auf der Sexualität. Man öffnet sich in diesem Bereich. Ich finde es jedoch ein bisschen schade, dass wir nur über diese Aspekte reden, denn ich glaube, dass eine Beziehungsöffnung auch in vielen anderen Bereichen guttun könnte.
Man könnte sich zum Beispiel überlegen: Mit wem möchte ich meine finanzielle Absicherung teilen? Das muss nicht meine Liebesbeziehungsperson sein. Das kann auch eine gute Freundin oder mehrere gute Freunde sein, zu denen ich sage: „Ich habe mit euch gemeinsam einen Altersfondtopf, in den wir jeden Monat Geld einzahlen.“ Oder: „Wir sparen zusammen auf ein Haus, das wir uns im Alter kaufen wollen.“
Oder man plant den Alltag anders: „Ich liebe dich, aber ich kaufe mit meinen Freunden das Essen, weil ich mit ihnen zusammenwohne“ … Man kann mit guten Freunden regelmäßig in den Urlaub fahren, anstatt mit der Partnerperson. Man kann mit ihnen einem Hobby nachgehen, das einem wichtig ist und die eigene Persönlichkeit ausmacht. Es gibt auf der Ebene der Lebensorganisation verschiedene Möglichkeiten, dies umzuverteilen.
Das ist es, was wir bei offenen Beziehungen wahrnehmen: Bedürfnisse und Wünsche auf sexueller Ebene werden erweitert. Manche Menschen haben zum Beispiel nicht den gleichen Kink wie ihre Partnerperson und möchten diesem dennoch nachgehen. Oder sie sind bisexuell und haben eine heterosexuelle Partnerperson, möchten aber auch diese Bedürfnisse stillen. Es gibt viele Varianten.
Zurück zur Transformation von Liebesbeziehungen: Die Schwierigkeit ist, dass aus zwei einzelnen Individuen ein Liebespaar wird – ein „Wir“. Gleichzeitig wollen wir Individuen bleiben. In unserer Zeit wird uns vermittelt, dass wir besonders und einzigartig sind. Wir sind wir und nicht die andere Person.
Wenn wir alles in diese Liebesbeziehung hineinpacken und uns wünschen, dass alles erfüllt wird, wird es schwierig herauszufinden, was eigentlich meins und nicht unser ist. Das kann beim Nachdenken darüber helfen, wie man eigene Bereiche bewahrt, ohne dass die andere Person dies als Gefahr, Abwertung oder Zurückweisung empfindet. Es sollte einfach akzeptiert werden: „Das ist, was mich als Person ausmacht, und das ist mein Bereich und den lasse ich meinem Gegenüber auch“ Diese Freiheit zu leben, ist eine Herausforderung.
Das ist vielleicht die größte Herausforderung, denn ich habe das Gefühl, dass es viel Mut braucht. Zunächst, um für sich selbst herauszufinden, was man eigentlich möchte, und dann, um dies mit der Partnerperson abzuklären und auf Verständnis zu stoßen. Vielleicht kommen wir jetzt vom Thema ab, aber ich habe neulich „Schneewittchen“ im Kino gesehen. Weil ich dein Buch im Kopf hatte, dachte ich bei der Szene, als es hieß, dass nur der wahre Kuss der Liebe sie retten könne: Warum muss das denn der Mann sein? Die Zwerge lieben sie doch auch! Zumal bei dem Film so viele Neuerungen dabei sind – warum porträtieren wir Liebe dann immer noch über diese eine Person?
Es sind Menschen, die diese Geschichten kreieren. Und wir sehnen uns nach diesen Geschichten, weil sie schöne Gefühle erzeugen. Ich habe mir neulich eine Westernserie angesehen, und am Ende ist die Protagonistin gestorben. Sie konnte die Person, in die sie sich verliebt hatte, nicht mehr sehen. Ich habe gemerkt, wie mich das emotional gepackt hat. Ich fand das interessant, denn eigentlich habe ich eine andere Perspektive darauf. Sie hat sich in der Serie für ihre Familie entschieden, und ich weiß doch, dass es andere Formen des Zusammenlebens gibt. Dennoch habe ich wieder gemerkt, dass diese Vorstellungen emotional tief in uns verankert sind.
Ich mache ja auch Workshops und Beziehungsberatungen. Ich versuche meinen Klient*innen und Teilnehmer*innen immer klarzumachen, dass es wirklich lange braucht, bis sich etwas verändert. Der Kopf ist das eine – wir können ein Bewusstsein entwickeln und Dinge wahrnehmen. Aber das ist nur der erste Schritt.
Menschen, die schon einmal therapeutisch in Behandlung waren oder an sich gearbeitet haben, wissen, dass es Jahre dauern kann, bis auch die Emotionen hinterherkommen. Und nicht nur, dass sie andere Emotionen haben, sondern diese dann auch anders framen und lesen.
Das ist etwas, was wir als Kinder lernen. Wir haben Schmetterlinge im Bauch, und dann erklärt uns eine erwachsene Person: „Ah, das liegt daran, dass du diese Person gesehen hast. Jetzt bist du ganz aufgeregt und hast dich bestimmt verliebt!“ So fängt das an. Statt zu sagen: „Das ist vielleicht Aufregung, weil du diesen Menschen spannend findest“ – eben ohne gleich das krass Romantische hineinzubringen. Viele Menschen kennen doch Friends Crushes: Man entdeckt Menschen, mit denen man viel Zeit verbringen möchte, ohne romantische Verliebtheitsgefühle zu haben. Man ist vielleicht auf eine Art verliebt, aber ohne sexuelle Anziehung. Man findet diese Menschen einfach spannend und verbringt gerne Zeit mit ihnen. Dabei kann man ebenfalls Schmetterlinge im Bauch haben.
Dein Beispiel ist schön, weil es zeigt, wie früh uns das beigebracht wird. Kinder bekommen diese Geschichten vorgesetzt und orientieren sich daran. Denn das ist es, was wir Menschen machen: Wir beobachten und orientieren uns an dem, was andere uns vormachen – so simpel ist es leider.
Ich würde sagen, dass man inzwischen eine vielfältigere Geschichtenerzählung wahrnimmt, auch über viele queere Konstellationen, von denen wir zunehmend mehr hören. Da muss man allerdings gerade beobachten, wie die weltpolitischen Veränderungen darauf Einfluss nehmen werden. Ich befürchte nichts Gutes. Aber noch haben wir das: Es gibt Kinderbücher, die vielfältiger sind, andere Themen aufgreifen und insgesamt inklusiver sind. Das ist eine gute Entwicklung.
An sich braucht es eben ganz viel Zeit – sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf persönlicher Ebene. Und dann kommen noch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, die strukturellen Mechanismen dazu. Wenn man in einer Familie lebt, Kinder hat, andere Verantwortlichkeiten trägt und in Institutionen eingebunden ist, macht es das nicht einfacher, innerhalb dieser Systeme persönliche Entscheidungen zu treffen. Auch hier sind die Bahnen sehr strukturiert und vorgegeben.
Ich habe durch die Interviews mit den Familien mitbekommen, wie schwierig es ist, zum Beispiel Mehr-Elternschaft oder Co-Elternschaft zu organisieren, wenn immer dieses Damoklesschwert über den Konstellationen hängt: „Ich bin rechtlich nicht abgesichert!“ Hinzu kommt das Romantikdiktat, das den leiblichen Eltern suggeriert, die dritte Person könnte sich verlieben, eine eigene Familie gründen und dann verschwinden. Gleichzeitig hat die dritte Person oft die Angst: „Irgendwann wollen sie doch ihr Kleinfamiliending machen und ich werde ausgeschlossen.“
Das ist eine enorme Herausforderung, mit der diese Menschen umgehen müssen. Was ich vor allem aus meinem neuen Buch mitgenommen habe, ist: Vertrauen ist eine bewusste Entscheidung. Etwas anderes bleibt auch nicht. Mit der Zeit wird dieses Vertrauen größer und die Stabilität der Konstellation nimmt zu. Doch auch hier gilt: Es braucht unfassbar viel Geduld und Zeit.
Und natürlich auch Mut! Wie oft gestehen wir uns denn zu, Dinge auszuprobieren und ihnen Zeit zu geben? Du schreibst in deinem Buch darüber, dass du beim Onlinedating die Erfahrung gemacht hast, dass ihr beide festgestellt habt: Wir finden uns toll, aber wir wollen gar keine Beziehung miteinander. Normalerweise wäre das der Punkt, an dem man nicht mehr miteinander spricht. Doch stattdessen den Mut zu haben, das Gespräch zu suchen und zu schauen: Was ist das hier? Und was könnte daraus werden?
Apropos Mut, du hast vorhin über Friends Crushs gesprochen, und ich dachte: Wie oft machen wir uns eigentlich bewusst, dass das etwas ganz Normales ist? Wir reden vielleicht insgesamt zu wenig über solche Erfahrungen. Denn nur durch den Austausch lernen wir uns selbst doch auch besser kennen.
Ich finde das ebenfalls total spannend. Das war auch der Grund, warum ich entschieden habe, in diesem Buch nicht nur meine Interviewpartner*innen und die Wissenschaft sprechen zu lassen, sondern mich selbst darin sozusagen „nackig“ zu machen. Sowohl im „Romantikdiktat“ als auch im neuen Buch gebe ich preis, was mich beschäftigt und umtreibt, weil es mir ein Anliegen ist, nicht so zu tun, als würde ich nur über andere sprechen. Mich beschäftigt das ja auch; es ist eine intrinsische Motivation gewesen. Ich habe angefangen, über Online-Dating zu forschen, weil ich selbst mit Online-Dating begonnen habe. Ich habe Menschen über Dating-Apps kennengelernt, und es ist so viel passiert. Das fand ich nicht nur als Person spannend, sondern auch als Wissenschaftlerin. Da kam beides zusammen, und ich wollte darüber arbeiten. Es ist ja auch ein neues Feld.
Ich habe nicht nur während meiner Arbeit, sondern auch sonst viel mit dem Konzept der Selbstbeobachtung gearbeitet. Ich bin gut darin, mich zu verstehen, zu lesen und mich selbst von außen zu betrachten. Das ist nicht immer ganz einfach, aber es wurde wesentlicher Teil meiner wissenschaftlichen Arbeit. Bis heute finde ich es spannend, diesen Reflexionsprozess abstrakter zu fassen und zu sehen, was sich in meinen Entwicklungen äußert, die natürlich mit der Gesellschaft zu tun haben.
Ich glaube, ich bin damit nicht allein. Es war für mich auch ein Grund, damit nach außen zu gehen, weil ich denke, dass sich andere Menschen darin wiedererkennen. Du hast es gerade angesprochen: Friends Crushs, das kennen viele, aber die wenigsten reden über diese Empfindung. Oder darüber, dass man total genervt von der Partnerperson sein kann. Dass man mal denkt: „Ich könnte kotzen.“ Das ist total normal.
Es geht genau darum, zu erkennen: Man ist mit diesen Gedanken und Gefühlen nicht allein. Ich kenne das Gefühl eines Friends Crushs auf jeden Fall, hatte nur bisher kein Wort dafür. Also danke, dass ich das jetzt habe.
Worüber ich auch noch gern mit dir sprechen wollte: Die romantische Liebe ist für uns hier im Westen recht klar umrissen. Wir haben eine gemeinsame Vorstellung davon, was sie ausmacht. Ich habe mich neulich mit einer Kollegin darüber unterhalten, dass die Liebe zum Beispiel auf den Philippinen anders definiert wird. Wer sind wir, dass wir sagen: Das macht Liebe und eine gute Partnerschaft aus? Es gibt so viele unterschiedliche Ansichten über die Liebe.
Ein Blick in die europäische Geschichte verrät uns, dass Liebe sehr unterschiedlich verstanden wurde. Vor über 300 Jahren haben Menschen auch bei uns aufgrund anderer relevanter Themen zusammengefunden oder wurden verpartnert. Dabei ging es meist um ökonomische Sicherheit, darum zu überleben. Aktuell ist es immer noch so, und das zeigt dein Beispiel wunderbar, dass es auf der Welt ganz verschiedene Konzeptionen von Partnerschaft, Liebe, Gemeinschaft oder Familie gibt.
Was bedeutet eigentlich Familie? Wir haben Mutter, Vater, Kinder im Kopf. Das ist unser eurozentristischer Blick. In anderen Gesellschaften wird das jedoch ganz anders verstanden. Ich habe viel im südlichen Afrika gearbeitet. Als ich noch studierte, war ich mehrmals in Namibia mit einem Professor, der viel zu diesem Thema geforscht hat. Dort werden z.B. alle Frauen auf der mütterlichen Linie Mutter genannt. Es wird nicht zwischen der biologischen Mutter oder den Geschwistern der Mutter unterschieden. Sie sind einfach alle Mütter.
Das müssen wir uns klar machen: Das sind gesellschaftlich erlernte Konzeptionen. Es heißt nicht, dass andere Formen des Zusammenlebens unnatürlich sind. Sie sind ein Resultat von Geschichte und Machtstrukturen.
Die romantische Liebe und die Kleinfamilie haben sich in Europa auch deshalb durchgesetzt, weil sie sehr gut zum kapitalistischen System passen. Das zeige ich in meinem Buch auf: Die freie Wahl der romantischen Liebe wurde geschichtlich plötzlich entscheidend, denn das Ich sucht sich selbst aus, wen es liebt, unabhängig davon, was die Gruppe sagt, der das Ich angehört. Die freie Wahl ist auch eine Grundvoraussetzung des Kapitalismus. Denn hier wähle ich ebenfalls selbst aus, was ich konsumiere und kaufe. Die Ausbreitung der romantischen Norm geht Hand in Hand mit der Industrialisierung und weiteren gravierenden Umwälzungen in Europa.
Die Idee der romantischen Liebe an sich ist älter. Romeo und Julia stammen aus der vorindustriellen Zeit. Doch die Norm, sich romantisch zu binden, ist etwa 250 Jahre alt. Mit den Umwälzungen der Industrialisierung in Europa hat sich diese Norm durchgesetzt. Die Norm ist bis heute so stark, dass wir nicht nur schief angesehen, wenn wir nicht in einer romantischen Beziehung leben. Es geht so weit, dass alles andere abgewertet wird. So als würde es nichts anderes geben.
Das zeigt sich auch daran, dass die meisten für Liebesbeziehungen einfach den Begriff „Beziehung“ nutzen. Es wird gar nicht differenziert, ob es sich um eine romantische Beziehung, Partnerschaft oder Ehe handelt. Hier bewusster und aktiver wahrzunehmen und zu gestalten, wie wir zusammenleben wollen und wie wir einander lieben, halte ich für essentiell für unsere Zukunft – als einzelne Menschen, als Familien und als Gesellschaft.




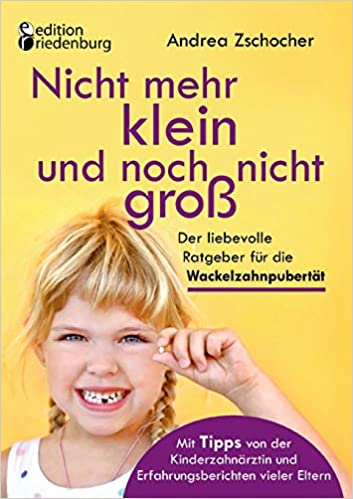
Neueste Kommentare